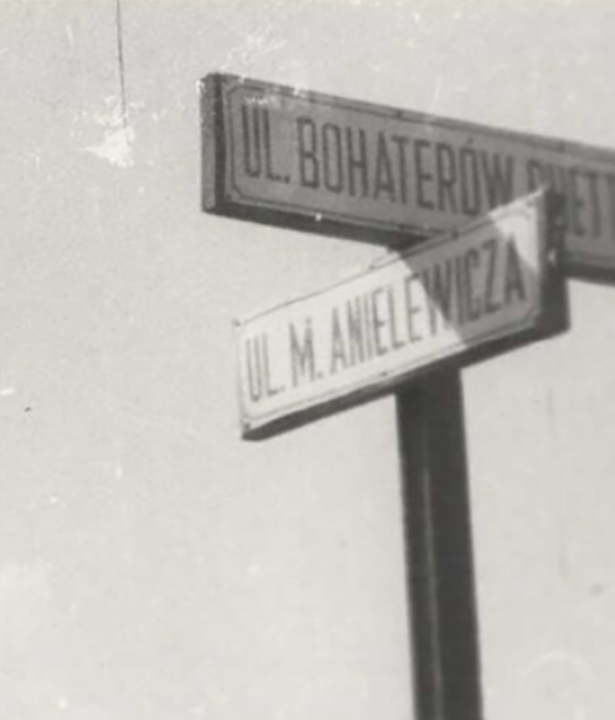Gegenstand der Forschung sind die jüdischen Lebenswelten im Kontext ihrer nichtjüdischen Umgebung von der Neuzeit bis in die Gegenwart. Mit Blick auf das mittlere und östliche Europa sowie den Räumen der Emigration (v.a. USA, Palästina/Israel) stehen Fragen politischer Teilhabe und Ausschluss, das Ringen um rechtliche und kulturelle Autonomie sowie Mobilitäts-, Exil- und Gewalterfahrungen im Mittelpunkt.
Text
Das Dubnow-Institut ist der säkularen Tradition seines Namensgebers Simon Dubnow (1860–1941) verpflichtet. Der russisch-jüdische Historiker wirkte als kultureller Mittler zwischen den Judenheiten aus Ost- und Westeuropa.
Jüdische Geschichte wird am Dubnow-Institut stets im Kontext ihrer nichtjüdischen Umgebung betrachtet und als Seismograf allgemeiner historischer Entwicklungen verstanden. Um der Komplexität der jüdischen Lebenswelten und der engen Verschränkung sozialer, politischer und kultureller Entwicklungen gerecht zu werden, verknüpft die Institutsforschung Ansätze der historischen Wissenschaften produktiv mit solchen aus anderen Geistes- und Sozialwissenschaften und schärft insbesondere ideen-, gedächtnis- und erfahrungsgeschichtliche Zugänge.
Durch Veranstaltungen, universitäre Lehre und eine breite Palette von Publikationen werden die Forschungsergebnisse einem Fachpublikum sowie einer interessierten Öffentlichkeit vermittelt. Dazu gehören unter anderem das zweisprachige, international renommierte »Jahrbuch des Dubnow-Instituts/Dubnow Institute Yearbook«; die »Schriftenreihe«; die Essayreihen »toldot« und »hefez« sowie das Magazin »Jüdische Geschichte & Kultur«. Auf dem Blog »Mimeo« bieten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Einblick in ihre aktuellen Forschungsprojekte. Die Spezialsammlung der Institutsbibliothek steht auch Studierenden und Gästen offen.
Eine wichtige Rolle spielt die nationale und internationale Forschungskooperation. Seit 2018 ist das Dubnow-Institut Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Darüber hinaus arbeitet es besonders eng mit der Universität Leipzig, der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig sowie mit der Hebräischen Universität Jerusalem zusammen. Zudem unterhält es enge Kontakte zu zahlreichen wissenschaftlichen Einrichtungen in Israel, den USA, Europa und Deutschland und stellt einen Ort des Austauschs für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt dar.


Stapel mit grünen, brauen und roten Büchern, Dubnow-Institut, Simon Dubnows Weltgeschichte des jüdischen Volkes in deutscher, hebräischer und jiddischer Fassung. Carina Röll, 2020, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Stapel mit grünen, brauen und roten Büchern, Dubnow-Institut, Simon Dubnows Weltgeschichte des jüdischen Volkes in deutscher, hebräischer und jiddischer Fassung. Carina Röll, 2020, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Text
Das Institut wurde 1995 als »Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e. V.« auf einen ein Jahr zuvor gefassten Beschluss des Sächsischen Landtags hin gegründet. Seit 1996 ist es durch einen Kooperationsvertrag mit der Universität Leipzig verbunden, seit Januar 2000 als dessen An-Institut. 2018 wurde das Dubnow-Institut in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen und heißt seitdem Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow (DI).


Dubnow-Institut, Eingangsbereich. Markus Kirchhoff, 2021, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Dubnow-Institut, Eingangsbereich. Markus Kirchhoff, 2021, Rechte vorbehalten - freier Zugang


Dubnow-Institut, Institutsbibliothek. Grit N. Scheffer, 2021, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Dubnow-Institut, Institutsbibliothek. Grit N. Scheffer, 2021, Rechte vorbehalten - freier Zugang