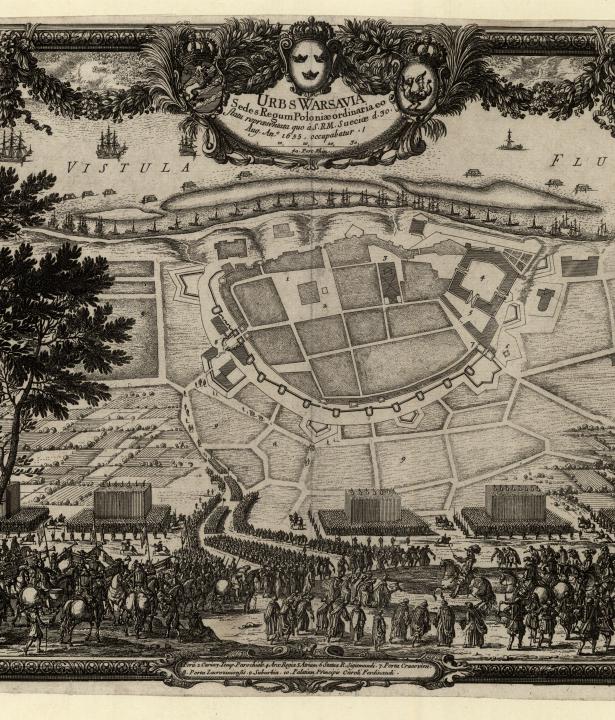Die barocke Sakralarchitektur der litauischen Hauptstadt
Vilnius ist die Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt Litauens. Sie liegt im südöstlichen Teil des Landes an der Mündung der namengebenden Vilnia (auch Vilnelė) in die Neris. Wahrscheinlich bereits in der Steinzeit besiedelt, datiert die erste schriftliche Erwähnung auf 1323; Magdeburger Stadtrecht erhielt Vilnius 1387. Von 1569 bis 1795 war Vilnius Hauptstadt des litauischen Großfürstentums in der polnisch-litauischen Adelsrepublik. Mit der dritten Teilung von Polen-Litauen verlor sie im Russischen Zarenreich diese Funktion. Erst durch die Gründung der Ersten Litauischen Republik 1918 wurde Vilnius kurzzeitig erneut Hauptstadt. Zwischen 1922 und 1940 gehörte Vilnius zur Republik Polen, weshalb Kaunas zur Hauptstadt Litauens ausgebaut wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg war Vilnius bis zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit Litauens 1990 Hauptstadt der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik.
Bereits im Mittelalter galt Vilnius als Zentrum der Toleranz. Insbesondere Juden fanden in Vilnius Zuflucht vor Verfolgung, so dass sich Vilnius bald als "Jerusalem des Nordens" einen Namen machte. Nicht zuletzt mit dem Goan von Wilna, Elijah Ben Salomon Salman (1720-1797), war Vilnius eines der bedeutendsten Zentren jüdischer Bildung und Kultur. Bis zur Jahrhundertwende war die größte Bevölkerungsgruppe die jüdische, während laut der ersten Volkszählung im russischen Zarenreich 1897 lediglich 2% der litauischen Bevölkerungsgruppe angehörten. Ab dem 16. Jahrhundert entstanden zahlreiche barocke Kirchen, die der Stadt auch den Beinamen "Rom des Ostens" eintrugen und die bis heute das Stadtbild prägen, während die zahlreichen Synagogen der Stadt im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Zwischen 1941 und 1944 unterstand die Stadt dem sog. Reichskommissariat Ostland. In dieser Zeit wurde fast die gesamte jüdische Bevölkerung ermordet, nur wenige konnten fliehen.
Auch heute noch zeugt die Stadt von einer "phantastische[n] Verschmelzung von Sprachen, Religionen und nationalen Traditionen" (Tomas Venclova) und pflegt ihre vielkulturelle Geschichte und Gegenwart.