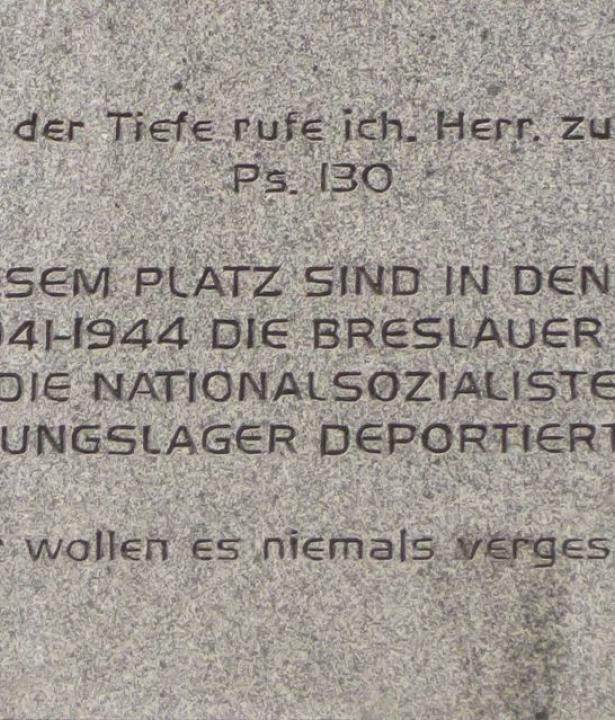„In meiner Familie gab es keine Erinnerungskultur“, sagt Verus von Plotho. Ein Weltbürger, 1969 in Sao Paulo, Brasilien, geboren, aufgewachsen in München. Seine Mutter ist Gabriele Freifrau von Plotho, die dritte Tochter von Heinrich und Gottliebe von Lehndorff. Über den Großvater und seinen Widerstand gegen Hitler wurde Zuhause kaum gesprochen, auch nicht über das frühere Leben auf Schloss Steinort. Enkel Verus wuchs – unbelastet – im Schatten der dramatischen Vergangenheit auf.
Abenteuer Familiengeschichte. Ein Weltbürger lernt die Heimat seiner Vorfahren lieben
Text
Von der kleinen Anhöhe unweit des Ufers, die Verus von Plotho für das Interview gewählt hat, schaut man weit über den Mauersee. An diesem Augustmorgen schimmert er blaugrau, über die leicht gekräuselte Wasseroberfläche jagen die Schwalben.1
Seit einigen Jahren verbringt er den Sommer am liebsten in Masuren. Dabei stand diese Weltgegend nicht unbedingt auf seiner Agenda. Als Junge hatte er kaum eine Vorstellung davon, war für ihn nur ein Name. Die wenigen Geschichten aus dem Leben der Vorfahren, die er hörte, waren von Tragik umgeben. Die Einzige, die hin und wieder offen darüber sprach, war die „berühmte Tante Vera“, die ältere Schwester der Mutter. Vera Gräfin Lehndorff, damals weltweit bekannt unter dem Namen „Veruschka“. Bis heute sind sie und Verus von Plotho einander verbunden.
Seit einigen Jahren verbringt er den Sommer am liebsten in Masuren. Dabei stand diese Weltgegend nicht unbedingt auf seiner Agenda. Als Junge hatte er kaum eine Vorstellung davon,
Sztynort
deu. Steinort, deu. Groß Steinort
Das Dorf Sztynort liegt im Norden der Masurischen Seenplatte auf der Halbinsel Jez zwischen Jezioro Mamry (Mauersee), Jezioro Dargin (Dargeinensee) und Jezioro Dobskie (Dobensee). Bis 1928 hieß das Dorf Groß Steinort, danach Steinort.


Verus mit 14 Jahren am Nordseewatt. Verus von Plotho, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Verus mit 14 Jahren am Nordseewatt. Verus von Plotho, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Text
„Sie hatte Größe. Und einen super Humor, war offen für Neues,“ erinnert sich Verus von Plotho. Ihrer beider Verhältnis war liebevoll, und es war rein privat. Auch die Gefühle für seinen Großvater, den er nur vom Hörensagen kannte. Sich öffentlich als Enkel eines Widerstandskämpfers zu zeigen, wäre ihm nicht in den Sinn gekommen, „damit konnte man sich als Heranwachsender nicht schmücken.“
In der Bundesrepublik galten die Männer des 20. Juli lange als Vaterlandsverräter. „Und die Generation der 68er hat sie als Reaktionäre gesehen, Feudalherren und Militärs, die erst im letzten Moment handelten.“ Alles Interesse, sagt Verus von Plotho, sei auf Stauffenberg fixiert gewesen, wie auch heute noch. „Auf ihn und ein paar andere. Der lebenslustige, eigentlich unpolitische Heinrich von Lehndorff passte nicht ins Schema.“
Weder er noch seine Witwe Gottliebe. Sie wollte nach 1945 keine der „Frauen des 20. Juli“ sein, wie Freya von Moltke oder Nina Schenk von Stauffenberg.2
„Meine Großmutter hatte mit ihrer Trauer schon genug zu tun. Wollte eigene Wege gehen. Sie war eine unabhängige, künstlerisch interessierte Frau.“ Offenbar ließ sie das Vergangene bewusst hinter sich, Adelswelt, Lebensstil, Ostpreußen, jeglichen Heroismus. „Ebenso waren die Töchter, meine Mutter und die drei Tanten, immer mehr in der Gegenwart als im Gedenken.“
In der Bundesrepublik galten die Männer des 20. Juli lange als Vaterlandsverräter. „Und die Generation der 68er hat sie als Reaktionäre gesehen, Feudalherren und Militärs, die erst im letzten Moment handelten.“ Alles Interesse, sagt Verus von Plotho, sei auf Stauffenberg fixiert gewesen, wie auch heute noch. „Auf ihn und ein paar andere. Der lebenslustige, eigentlich unpolitische Heinrich von Lehndorff passte nicht ins Schema.“
Weder er noch seine Witwe Gottliebe. Sie wollte nach 1945 keine der „Frauen des 20. Juli“ sein, wie Freya von Moltke oder Nina Schenk von Stauffenberg.2
„Meine Großmutter hatte mit ihrer Trauer schon genug zu tun. Wollte eigene Wege gehen. Sie war eine unabhängige, künstlerisch interessierte Frau.“ Offenbar ließ sie das Vergangene bewusst hinter sich, Adelswelt, Lebensstil, Ostpreußen, jeglichen Heroismus. „Ebenso waren die Töchter, meine Mutter und die drei Tanten, immer mehr in der Gegenwart als im Gedenken.“


Marion Dönhoff, 1963, in Steinort. Archiv Marion Dönhoff Stiftung, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Marion Dönhoff, 1963, in Steinort. Archiv Marion Dönhoff Stiftung, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Annäherung an die Familiengeschichte
Text
Es war der Kontakt zu Marion Dönhoff, der Verus von Plotho die Geschichte näherbrachte. Er las „Namen, die keiner mehr nennt“, „Kindheit in Ostpreußen“, konnte sich danach die Schönheit Masurens und das Leben auf den Adelsschlössern ein wenig vorstellen.
Die Publizistin und sein Großvater Heinrich waren derselbe Jahrgang, Cousine und Cousin, einander sehr nahe, zuletzt im Widerstand gegen Hitler. Den Studenten Verus beeindruckte vor allem Marion Dönhoffs klare politische Haltung: Ihr öffentlicher Verzicht auf die geliebte Heimat – in den 1960er Jahren – hatte den Weg zur Versöhnung mit bereitet.
Die Publizistin und sein Großvater Heinrich waren derselbe Jahrgang, Cousine und Cousin, einander sehr nahe, zuletzt im Widerstand gegen Hitler. Den Studenten Verus beeindruckte vor allem Marion Dönhoffs klare politische Haltung: Ihr öffentlicher Verzicht auf die geliebte Heimat – in den 1960er Jahren – hatte den Weg zur Versöhnung mit
Polen
eng. Poland, pol. Polska
Polen ist ein Staat in Mittelosteuropa, ein Mitglied der Europäischen Union. Unter dem heutigen Namen ist das Land seit dem 10. Jahrhundert bekannt.


Verus von Plotho und seine Großtante Marion Dönhoff, 1995. Verus von Plotho privat, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Verus von Plotho und seine Großtante Marion Dönhoff, 1995. Verus von Plotho privat, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Text
Bereits 1963 übrigens war sie wieder in Masuren gewesen, zum ersten Mal nach dem Krieg. Von Hamburg aus fuhr sie dorthin, in Begleitung ihres Neffen Hermann Hatzfeldt.
Unter anderem machte sie Station in Steinort, die elegante Dame im Porsche erregte Aufsehen, erzählt man noch heute in Sztynort. Mit ihrer Leica hielt sie das Schloss fest, es war damals noch ziemlich intakt, und die ungeheure Weite des Mauersees.
Unter anderem machte sie Station in Steinort, die elegante Dame im Porsche erregte Aufsehen, erzählt man noch heute in Sztynort. Mit ihrer Leica hielt sie das Schloss fest, es war damals noch ziemlich intakt, und die ungeheure Weite des Mauersees.
Text
Eines Tages saß Verus von Plotho an eben diesem See. Vierzig Jahre musste er werden, als Musik-Manager hatten er schon einige Stationen hinter sich. In Brasilien geboren, in London und New York studiert und bei Plattenfirmen gearbeitet, später in Berlin als Geschäftsführer bei einem bekannten Musik-Streamingdienst.
Ein wichtiger Impuls war das Projekt „Doppelleben“ von Antje Vollmer. Bei ihren Recherchen auf den Spuren von Heinrich und Gottliebe von Lehndorff hatte sie auch ihn befragt. „Mir, wie auch den Anderen in der Familie, wurde klar, wie wenig wir eigentlich wussten.“ Das Buch, das 2010 erschien, war ein Geschenk. Ein Fundus, reich an Quellen. Familiengeschichte, Zeitumstände, scharfsinnig und empathisch erzählt.
Ein wichtiger Impuls war das Projekt „Doppelleben“ von Antje Vollmer. Bei ihren Recherchen auf den Spuren von Heinrich und Gottliebe von Lehndorff hatte sie auch ihn befragt. „Mir, wie auch den Anderen in der Familie, wurde klar, wie wenig wir eigentlich wussten.“ Das Buch, das 2010 erschien, war ein Geschenk. Ein Fundus, reich an Quellen. Familiengeschichte, Zeitumstände, scharfsinnig und empathisch erzählt.


In Boston, 2019. Verus von Plotho, Rechte vorbehalten - freier Zugang
In Boston, 2019. Verus von Plotho, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Text
Als am 22. Juni 2009 in Steinort der 100. Geburtstag seines Großvaters gefeiert und am Schloss ein Gedenkstein eingeweiht wurde, war er dabei. Fast die gesamte, in Europa verstreute Familie war gekommen. „Das war sehr emotional.“ Endlich hatte sie einen Ort zum Trauern. „Es gab ja kein Grab, seine Asche wurde auf den Rieselfeldern bei Berlin ausgekippt.“


Familientreffen in Steinort 2009. Von links: Verus von Plotho, seine Schwester Anna, Gabriele Freifrau von Plotho. Vera Gräfin Lehndorff, Nona von Haeften, Dirk von Haeften, Josefa von Haeften, Catharina Kappelhoff-Wulff, Christopher Kappelhoff-Wulff. Kilian Heck, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Familientreffen in Steinort 2009. Von links: Verus von Plotho, seine Schwester Anna, Gabriele Freifrau von Plotho. Vera Gräfin Lehndorff, Nona von Haeften, Dirk von Haeften, Josefa von Haeften, Catharina Kappelhoff-Wulff, Christopher Kappelhoff-Wulff. Kilian Heck, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Text
Seitdem verbrachte Verus von Plotho immer öfter seine Sommer in Masuren. Bald war er der Natur verfallen, Wasser, Himmel, „das Übliche, das alle lieben.“ Ihm war wichtig, diesen Platz selbst zu erschließen, er wollte nicht nur aus der Vergangenheit heraus leben und für die Hiesigen „der Lehndorff-Enkel“ sein.
Sommer in Masuren
Text
Segeln ist das Allerschönste hier. Ferienfreuden weitab von Berlin, wo Verus von Plotho heute lebt. Hier, in der masurischen Landschaft, ist er seinem Großvater nahegekommen. „Er war ein Mensch der Natur, der Jagd, liebte das Reiten. Er hatte ein tolles Leben, denke ich.“


Mauersee heute. Ulla Lachauer, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Mauersee heute. Ulla Lachauer, Rechte vorbehalten - freier Zugang


Gottliebe Lehndorff mit Fischern, ca. 1940. Archiv Marion Dönhoff Stiftung, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Gottliebe Lehndorff mit Fischern, ca. 1940. Archiv Marion Dönhoff Stiftung, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Text
Manchmal betrachtet er die Hochzeitsfotos seiner Großeltern. Eines hängt als Kopie in der kleinen Ausstellung im Schloss. „Sieben gute Jahre, von 1937 bis 1944, hatten die beiden.“ Selbst in dem Abschiedsbrief, den Heinrich von Lehndorff am Tag vor seiner Hinrichtung an Gottliebe schrieb, meint sein Enkel Verus, sei noch etwas von der Leichtigkeit dieses früheren Lebens zu spüren. „Fröhlich“ nennt der Todgeweihte sein „kurzes Leben“, und so möchte er in Erinnerung bleiben.
„Da ist so unheimlich viel drin, in diesem Brief. Tiefe Liebe zu seiner Familie. Freude und Hoffnung. Mut, dem eigenen Gewissen zu folgen und dafür alles aufzugeben.“ Diese Haltung bewundert Verus von Plotho, er ist heute stolz auf seinen Großvater. Ihn als „Helden“ zu bezeichnen, fände er überhöht, treffender wäre: „ein Mensch, der uns Vorbild sein kann“.
„Da ist so unheimlich viel drin, in diesem Brief. Tiefe Liebe zu seiner Familie. Freude und Hoffnung. Mut, dem eigenen Gewissen zu folgen und dafür alles aufzugeben.“ Diese Haltung bewundert Verus von Plotho, er ist heute stolz auf seinen Großvater. Ihn als „Helden“ zu bezeichnen, fände er überhöht, treffender wäre: „ein Mensch, der uns Vorbild sein kann“.


Ausstellung in Schloss Steinort: Hochzeit von Gottliebe von Kalnein und Heinrich von Lehndorff, 1937. Familienarchiv Lehndorff, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Ausstellung in Schloss Steinort: Hochzeit von Gottliebe von Kalnein und Heinrich von Lehndorff, 1937. Familienarchiv Lehndorff, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Text
Als Vertreter der Familie engagiert er sich für den Erhalt und die Zukunft des Schlosses. Nüchtern und klar beschreibt er seine Vorstellungen: „Das Steinorter Schloss ist ein großer Bau mit vielen Zimmern.“ Seine Rettung und Nutzung sind eine riesige Herausforderung. „Und er befindet sich mitten in Polen. Es geht um die Geschichte und Bedürfnisse der Hiesigen.“
Text
Um das Schicksal der Dorfbewohner und ihre Beziehung zum Schloss seit 1945, „ihre Biografien müssen erzählt werden.“ In einer künftigen Ausstellung sollte die Adelsfamilie von einst und der Widerstand gegen Hitler nur ein Aspekt von vielen sein.
Inzwischen kennt Verus von Plotho viele Sztynorter Geschichten, die erstaunlichste hat ihm Jurek Dacko berichtet. Sein Vater ist 1941 aus der Ukraine hierher verschleppt worden, hat als Zwangsarbeiter bei den Lehndorffs im Pferdestall gearbeitet und ist nach Kriegsende geblieben.
Inzwischen kennt Verus von Plotho viele Sztynorter Geschichten, die erstaunlichste hat ihm Jurek Dacko berichtet. Sein Vater ist 1941 aus der Ukraine hierher verschleppt worden, hat als Zwangsarbeiter bei den Lehndorffs im Pferdestall gearbeitet und ist nach Kriegsende geblieben.
Wichtiger als die Vergangenheit ist die Frage, was hier und jetzt gebraucht wird und Sinn hat: Versorgung der Segeltouristen, Restaurant, Café, Hotel, Co-Working Büros für Digital Natives, vielleicht eine Waldakademie. Berufliche Bildung für die wirtschaftlich arme Region, Arbeitsplätze für die Dorfjugend – das vor allem.


Verus von Plotho und der Sztynorter Jurek Dacko. Verus von Plotho, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Verus von Plotho und der Sztynorter Jurek Dacko. Verus von Plotho, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Text
Verus von Plotho hofft auf gute Zusammenarbeit mit der Firma King Cross, die 2018 den Hafen und das Gelände rings um das Schloss übernommen hat. In diesem August 2020 hat er sich die verwilderte barocke Parkanlage genauer angeschaut. Die früheren Sichtachsen sind inzwischen freigelegt, die alte Eichenallee, die Teehaus und Kapelle verbindet, ist wieder passierbar.


Eichenallee am Schloss heute. Ulla Lachauer, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Eichenallee am Schloss heute. Ulla Lachauer, Rechte vorbehalten - freier Zugang


Anfang der 1940er Jahre. Ostpreußisches Landesmuseum, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Anfang der 1940er Jahre. Ostpreußisches Landesmuseum, Rechte vorbehalten - freier Zugang
Text
Manche der Baumriesen aus dem 17. Jahrhundert sind tot, Teile des Geländes versumpft. „Was kann man bewahren? Viel zu tun, bevor man neugestalten kann. Und wie könnte heute so eine Gartenarchitektur aussehen?“
Und wieder ist sein Großvater gegenwärtig: Durch den Park ist Heinrich von Lehndorff am 20. Juli 1944 vor der Gestapo geflüchtet. Nach einem Sprung aus dem Fenster rannte er Richtung Wald. Wo er sich auskannte, „und sich sicher bewegen konnte, fast wie ein Tier.“
Und wieder ist sein Großvater gegenwärtig: Durch den Park ist Heinrich von Lehndorff am 20. Juli 1944 vor der Gestapo geflüchtet. Nach einem Sprung aus dem Fenster rannte er Richtung Wald. Wo er sich auskannte, „und sich sicher bewegen konnte, fast wie ein Tier.“